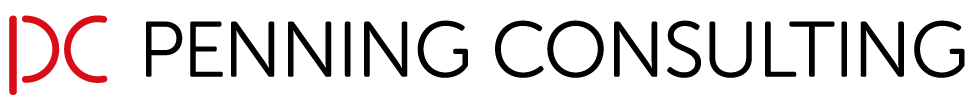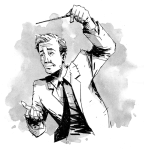Egoismus als Führungsprinzip – eine kritische Auseinandersetzung mit Dark Leadership
Ist egoistische Führung der Schlüssel zum Erfolg? Diese provokante These gewinnt im Diskurs über moderne Leadership-Konzepte zunehmend Aufmerksamkeit – nicht zuletzt als Gegenpol zu altruistisch geprägten Führungsmodellen. In diesem Beitrag über Führungsnarrative widmen wir uns der dunkleren Seite der Führung: Egoismus als Führungsstrategie.
Zwischen Klartext und Karikatur: Was bedeutet egoistische Führung?
Egoistische Führung meint nicht zwangsläufig Rücksichtslosigkeit oder moralisches Fehlverhalten. Sie beschreibt vielmehr eine Haltung, in der die eigenen Interessen – Karriere, Status, Einfluss – über das Gemeinwohl gestellt werden. Entscheidungen werden danach getroffen, was der Führungskraft nützt, nicht notwendigerweise dem Team.
Eigenschaften egoistisch handelnder Führungskräfte:
- hohe Zielorientierung und Durchsetzungskraft
- Fokus auf persönliche Macht und Kontrolle
- Bereitschaft zu unpopulären Entscheidungen
- strategische Nutzung von Netzwerken für den eigenen Vorteil
- geringe emotionale Bindung zum Team
Das System belohnt Egoisten – oft stillschweigend
In seinem Buch Leadership BS (2015) beschreibt Jeffrey Pfeffer eindrucksvoll, warum moralisch integreres Verhalten in der Praxis selten belohnt wird. Vielmehr seien es egoistische, dominante Führungspersönlichkeiten, die Karriere machen – nicht, weil sie empathisch führen, sondern weil sie sich durchsetzen.
Warum funktioniert das (zumindest kurzfristig)?
- Egoistisch denkende Führungskräfte treffen Entscheidungen schneller.
- Sie zeigen weniger emotionale Unsicherheit.
- Sie stellen ihre persönlichen Ziele kompromisslos in den Vordergrund.
- Sie investieren ihre Zeit in den Aufbau von karrierefördernden Netzwerken
In Organisationen, die Leistung primär über Ergebnisse und nicht über den Weg dorthin messen, ist das ein strategischer Vorteil – zumindest auf den ersten Blick.
Was gewinnen wir durch egoistische Führung?
- Entschlossenheit: Egoistische Führungskräfte scheuen keine Konflikte und übernehmen Verantwortung – auch für unpopuläre Entscheidungen.
- Fokus: Wer sich nicht emotional belastet, kann klarer priorisieren.
- Ergebnisse: In dynamischen, wettbewerbsintensiven Märkten kann diese Haltung kurzfristige Vorteile verschaffen.
Doch was verlieren wir dabei?
Die Schattenseite dieser Führung ist deutlich spürbar, vor allem auf kultureller Ebene:
- Vertrauensverlust: Mitarbeiter erkennen schnell, wenn ihre Führungskraft nur auf den eigenen Vorteil bedacht ist. Das wirkt demotivierend.
- Fluktuation: Mangelndes Commitment im Team führt zu innerer Kündigung oder tatsächlicher Abwanderung.
- Toxische Kultur: Wenn Macht über Kooperation gestellt wird, entsteht ein Klima des Misstrauens.
- Fehlende Innovationskraft: Eine angstbasierte Führung hemmt Offenheit, Lernbereitschaft und Kreativität.
Langfristig kann sich ein egoistisch geprägter Führungsstil also gegen das Unternehmen selbst wenden – durch Reputationsverluste, hohe Fluktuationskosten und sinkende Identifikation.
Die Frage ist nicht: egoistisch oder altruistisch, sondern bewusst oder unbewusst?
Wir plädieren nicht für eine moralische Verurteilung, sondern für eine differenzierte Auseinandersetzung. Denn: Auch egoistisches Handeln kann Teil einer bewussten Führungsstrategie sein – solange es eingebettet ist in reflektierte Strukturen, Feedbackprozesse und einen übergeordneten Unternehmenszweck.
Ein zukunftsfähiger Umgang mit Egoismus in Führung:
- Reflexion ermöglichen: Führungskräfte sollten ihr eigenes Führungsnarrativ kennen und kritisch hinterfragen.
- Führung nicht allein belohnen: Die Zielerreichung sollte mit Teamwirkung und werteorientiertem Verhalten verknüpft werden.
- Feedbackkultur stärken: Mitarbeiter sollten die Möglichkeit haben, Führungsverhalten zu spiegeln, ohne Repressalien erwarten zu müssen.
- Narrative sichtbar machen: Welche Führungsbilder werden in der Organisation belohnt? Welche stillschweigend akzeptiert?
Egoistische Führung – wirksames Prinzip oder kulturelle Sackgasse?
Egoismus in der Führung mag kurzfristige Vorteile bringen – doch auf lange Sicht steht er im Konflikt mit Vertrauen, Loyalität und Teamorientierung. Führungskräfte, die nur auf sich selbst fokussiert sind, erzeugen Ergebnisse, aber selten Nachhaltigkeit.
Wir brauchen also eine Führung, die Selbstinteresse mit Verantwortung und persönliche Ziele mit kulturellem Anspruch verbinden kann. Die eigenen Ziele zu verfolgen, ist legitim, solange sie nicht auf Kosten anderer, sondern im Einklang mit der Organisation verwirklicht werden.
Sie möchten Ihre Führungskultur reflektieren und neue Narrative entwickeln?
Penning Consulting begleitet Organisationen in der Auseinandersetzung mit Führungsrealitäten, Führungsbildern und der Entwicklung zukunftsfähiger Leadership-Kultur.